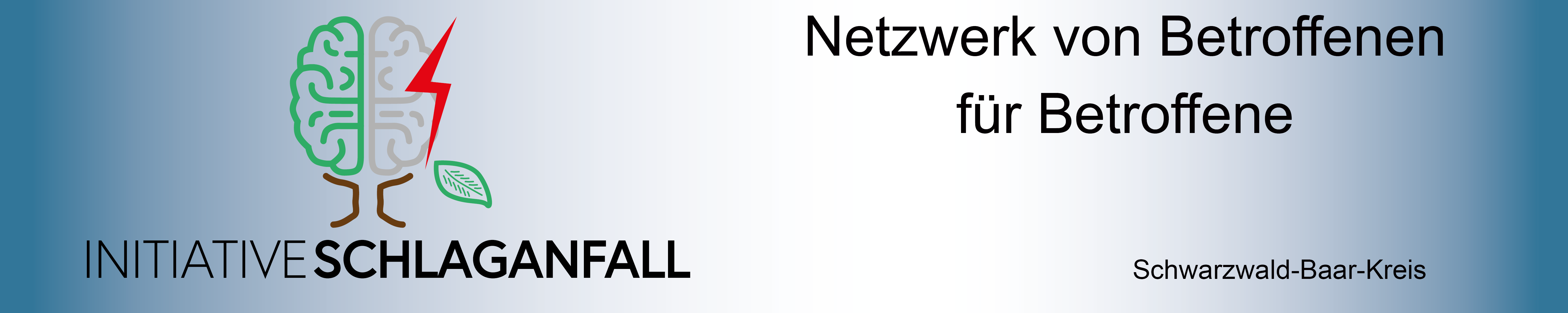Lebensqualität trotz unheilbarer Erkrankung? Und was hat Palliativmedizin mit einem Mantel zu tun?

Dr. Schaumann, Palliativmediziner im Palliativzentrum im Schwarzwald-Baar Klinikum bei seinem Vortrag: „Im Englischen heißt es Palliativ-Care. Pallium ist der Mantel – wir möchten unsere Patienten und auch die Angehörigen mit einem Mantel umhüllen, wir möchten sie schützen und unter dem Mantel gerne betreuen. Der Mantel sollte nicht dem Arzt, sondern dem Patienten gefallen, er sollte sich darin wohlfühlen, seine Eigenheiten berücksichtigen, er sollte ihn Umhüllen, aber ihm auch Luft lassen und gut zu tragen und auch zu ertragen sein. Palliativmedizin ist in hohem Maße Individualmedizin, es geht immer um den Einzelnen jeweils“.
Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben!
Das was Cicely Saunders, die Begründerin der modernen Hospizbewegung und der Palliativmedizin damit sagte, entspricht auch dem Grundsatz der Palliativmediziner.

Dr. Schaumann: „Palliativmedizin bedeutet, die Krankheit ist nicht oder nicht mehr heilbar. Unser Therapieziel ist ein anderes: Die Krankheit aufhalten, ausbremsen, stabilisieren oder auch in ein besseres, verträglicheres Stadium zurückführen, und unsere Aufgabe ist, die Therapie so zu gestalten, dass sie nicht schlimmer als die eigentliche Erkrankung ist. Wir fragen, was können wir dem Patienten als Belastung zumuten, für uns geht es um Lebenszeit mit Lebensqualität für den Patienten. Es interessiert uns weniger, mit welcher Grunderkrankung ein Patient zu uns kommt, das Vordringliche ist, die Folgen der Erkrankung in den Griff zu bekommen“.
Da kann man nichts mehr machen.
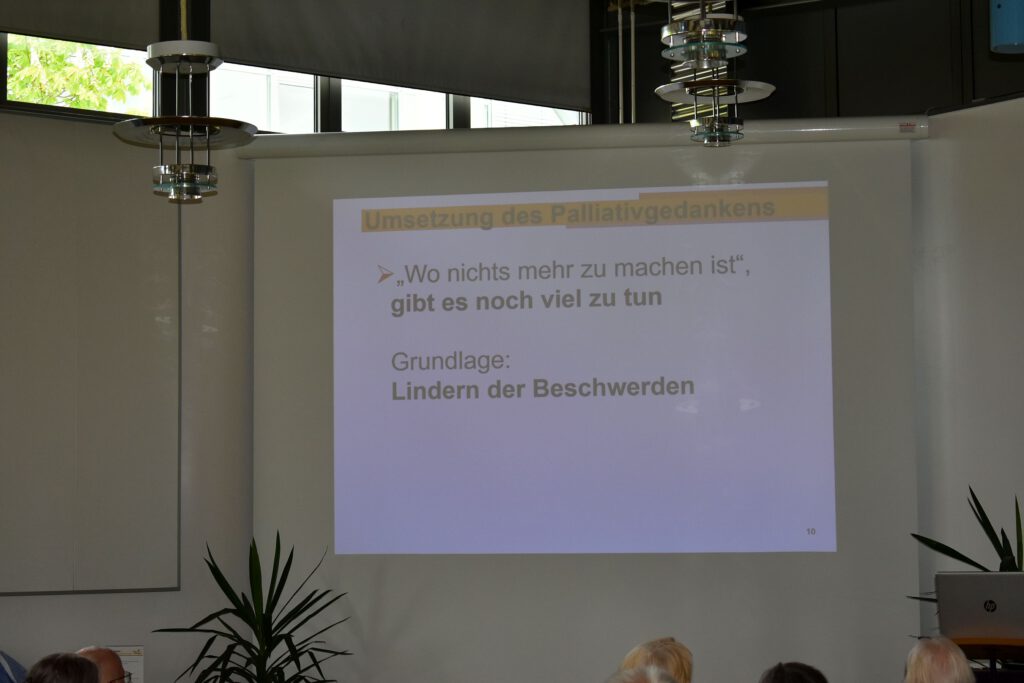
Dr. Schaumann: „Dieser immer noch häufig gehörte Satz stimmt nicht, denn man kann noch eine ganze Menge tun. Grundlage ist die Beschwerdelinderung, ein sehr multidimensionales Feld. Es geht um körperliche Leiden, um psychische Leiden aufgrund der Erkrankung wegen der begrenzten Lebenszeit, um Krankheitsverarbeitung, um Soziales, weil ich meine eigentliche Rolle nicht mehr erfüllen kann, es geht um die Familie und manchmal auch um den Beruf und um die Frage: Warum passiert das mir jetzt“.
Wir fragen sehr früh: Was sind die Symptome der Erkrankung?

Dr. Schaumann: „Klar ist, im Vordergrund steht die Schmerztherapie, aber es geht eben neben den körperlichen Schmerzen auch um psychische und spirituelle Schmerzen, viele der Patienten leiden unter Übelkeit und Erbrechen, die Linderung von Atemnot ist ein großes Thema bei uns, und Angst und Unruhe sind häufige Symptome. Mundtrockenheit und Durstgefühle, bei anderen Patienten offene Wunden, oder auch dicke Arme oder dicke Beine aufgrund von Wassereinlagerungen an falschen Stellen – mit all diesen vielen unterschiedlichen Symptomen muss der Patient mit Unterstützung durch uns Palliativmediziner zurechtkommen“.
Wie hilft ein Genogramm?
Dr. Schaumann: „Ein Genogramm wird zu Beginn von jedem Patienten erstellt, es zeigt auf, wie die familiären Verhältnisse sind, wer kann „gut“ mit wem, wer ist für den Patienten eine Stütze und bei wem ist es eher schwierig, so können wir eher unterstützen.
Es wird versucht für den Patienten ein individuelles Konzept maßzuschneidern, das dem großen Fundus an Problemen des Patienten gerecht wird. Ein Gespräch hilft oftmals zu klären, was ist das Hauptproblem, wo sind die Schwierigkeiten, wo sind schützende Maßnahmen nötig. Wir fragen nach Belastungsfaktoren, wie sind die Ressourcen des Patienten, die familiäre Situation, wie ist das soziale Gefüge. Das kann manchmal eine zusätzliche Belastung sein aber auch eine ganz wertvolle Ressource“.
Was hat ein Werkzeugkoffer mit den Patienten zu tun?

Dr. Schaumann: „Der Werkzeugkoffer enthält Medikamente zur Schmerztherapie, zur Therapie von Angst und Übelkeit, Aromatherapie um ergänzend zu helfen. Das hat nichts mit Alternativmedizin zu tun, die vorschreibt nur das und das nicht zu wollen.
Ganz wichtig sind in unserem Team die psychotherapeutische und die physiotherapeutische Unterstützung. So können Patienten die schwach sind oder infolge von Schmerzen in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, wieder im Alltag besser funktionieren. Das geht aber nur unter Einbeziehung der Angehörigen“.
Wie ist die aktuelle Belastungssituation des Patienten?

Dr. Schaumann: „Die Frage für den Palliativmediziner ist nicht, mit welcher Krankheit kommt ein Patient, sondern wie kann geholfen werden. Mit dem Patienten müssen realistische Ziele besprochen werden. Ziele können sein: Ich möchte noch einmal nach Hause gehen, ich möchte wieder gehen können, ich möchte gerne wieder einmal nachts durchschlafen können ohne Luftnot oder Panikattacken zu bekommen, ich möchte wieder Ruhe finden, ich möchte meiner Familie vermitteln, wie meine aktuelle Situation ist“.
Palliativmedizin ist Mannschaftssport, Einzelkämpfer sind nicht gefragt.
Dr. Schaumann: „Um gesetzte Ziele zu erreichen, wird alles im Team kommuniziert, dazu gehören die tägliche Teambesprechung und 2 wöchentliche Konferenzen, wo jede Berufsgruppe ihre Einschätzung mit allen teilen kann. Dabei geht es auch um die Frage, wie gestaltet man die „letzte Lebensphase“, die nur wenige Tage dauern könnte, aber auch mehrere Monate. Wie möchte der Patient das gestalten und wo möchte er es?
Den Patienten werden Dinge angeboten, die im normalen Krankenhausalltag nicht möglich sind. Ein Haustier kann da schon mal kommen, Kunsttherapie – Zeichnen als Ausdrucksform und Musiktherapie werden angeboten. Für die Patienten sind Palliativmediziner, Pflegefachkräfte die fast alle eine spezielle palliativmedizinische Weiterbildung absolviert haben, Psychoonkologen, die Physiotherapie und ein eigener Sozialdienst da.
Regelmäßig kommen Ehrenamtliche ins Palliativzentrum, die sich die Zeit nehmen, mit den Patienten über alle möglichen Themen sprechen, sie bringen ein Stück Alltag mit. Wichtig für viele Patienten ist ein Seelsorger, mit dem die Patienten über Gott aber auch über die Welt reden können, der aber auch ein begnadeter Musiker und bildender Künstler ist. Unsere entscheidende Frage ist immer: Profitiert der Patient auch davon?“

Hält Essen und Trinken am Lebensende wirklich Leib und Seele zusammen?
Dr. Schaumann: „Ernährung kann bei Schwererkrankten möglicherweise Übelkeit erzeugen, es ist ein schwieriges Thema. Es ist auch so, dass der Körper in der Sterbephase bestimmte Funktionen herunterfährt. Wenn der Stoffwechsel herunterfährt, tut man dem Körper nicht mehr Gutes, ihn „zu füttern“. Wichtig ist, dass Angehörige verstehen, jetzt geht die Liebe nicht mehr durch den Magen. Die Hand halten, Vorlesen, Fotos ansehen und miteinander reden sind wichtiger. Ein Tropfen des ehemals geliebten Essens gibt den Geschmack und belastet nicht den Magen, das Lieblingsgetränk als Eiswürfel einfrieren und zum Lutschen geben funktioniert gerade dann, wenn es Schluckbeschwerden gibt.
Besonders bei den Angehörigen muss die Erkenntnis ankommen, der Patient stirbt nicht, weil er aufhört zu essen und zu trinken, sondern weil er stirbt hört er auf zu essen und zu trinken“.

Was heißt das: palliatives Netzwerk?
Fakten: Zum Bereich des Palliativzentrums gehört der Bereich Schwarzwald-Baar – Heuberg mit den Kreisen Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen mit ca. 500.000 Einwohnern, verteilt auf ca. 2.500 km². Für die spezialisierte und stationäre Palliativmedizinische Komplexbehandlung gibt es nur dieses eine Palliativzentrum mit 12 Betten. Der Vorteil der Nähe zum Klinikum bedeutet, alle Strukturen können genutzt werden, das onkologische Zentrum, das Pharmazentrum, die Ernährungsberatung, alle Großgeräte die es für die Diagnostik gibt, sodass Endoskopien im Zweifel durchgeführt werden können aber auch die Chirurgie.
Das Ziel ist, Patienten wieder zu entlassen, 12 Betten sind nicht viel… Ein Drittel der Patienten geht wieder nach Hause, kann aber in einer Krisensituation möglicherweise wiederkommen. Ein weiteres Drittel kommt in eine versorgende Einrichtung – in eines der 2 Hospize oder in eine der Pflegeeinrichtungen, die inzwischen den Palliativ-Care Gedanken pflegen. Ein Drittel der Patienten verstirbt aber auf der Palliativstation. Die Palliativstationsbehandlung ist eine Krankenkassenleistung.
Es gibt in unserer Region zwei stationäre Hospize, die jeweils in privater Trägerschaft stehen und 5% der Mittel durch private Spenden aufbringen müssen.
Es gibt aber auch die ambulante palliativmedizinische Betreuung für zu Hause mit den so genannten SAPV-Teams.